Schublade auf, Identität rein

Intro
Erkennst Du auf den ersten Blick, wer eine Lesbe ist? Wenn Du die Menschen an der Supermarktkasse, im Wartezimmer oder im Bus betrachtest, weißt Du sofort, wer von ihnen homo und wer hetero ist? Wer von ihnen arbeitslos ist? Wer eine schwere Vergangenheit hatte? Welche von ihnen Prostituierte und welche Freier sind? Oder ist das alles gar nicht so wichtig? Die Entscheidung, ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht, fällt innerhalb von 150 Millisekunden, ist vollkommen irrational und schwer zu korrigieren. Wir glauben, einen Menschen einschätzen zu können, weil wir von den Merkmalen, die wir innerhalb dieser extrem kurzen Zeitspanne wahrnehmen, automatisch auf weitere schließen.
Die gefühlte Identität
Um zu verstehen, wieso Menschen dazu neigen, sich selbst und andere in Schubladen zu stecken, müssen wir anerkennen, dass jeder von uns sich nach einer eindeutigen Identität sehnt. Es sind Fragen, die das Handeln zahlloser Filmhelden und literarischer Protagonisten bestimmen. Fragen, deren Dringlichkeit wir nachempfinden und mitfühlen können: Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Dahinter steht der Wunsch, sich selbst einer Identität zuzuordnen, die erst einmal nichts anderes ist als eine Schublade, auf der die ethnische Herkunft, der gesellschaftliche Status und/oder die Zugehörigkeit zu einer Interessengemeinschaft vermerkt sind.
Problematisch wird es erst, wenn wir anhand dessen pauschal bestimmte Klischees assoziieren. Eine Lesbe als solche anzuerkennen ist grundsätzlich richtig, sie aber anhand bestimmter Eigenschaften durch ein Raster (kurze Haare, unrasierte Achseln, hasst Männer – ihr kennt das) in die Schublade „Lesbe“ zu pressen, völlig unangemessen.
Selbstbild und Identität
Leider ist Identität etwas Gefühlsabhängiges und gleichzeitig sehr Starres. Wer einmal eine Überzeugung verinnerlicht hat, verteidigt sie mit Klauen und Zähnen, notfalls auch gegen Fakten. Das gilt nicht nur für die Bilder, die wir uns von anderen machen, sondern vor allem für unser Selbstbild. Wird unser Selbstbild angegriffen oder infrage gestellt, stürzt uns das in eine Identitätskrise. Um das zu vermeiden, kann unsere Psyche die abstrusesten Abwehrmechanismen in Gang setzen, über die wir, wenn wir uns selbst als neutraler Beobachter wahrnähmen, nur den Kopf schütteln könnten. Bevor wir unser Selbstbild über den Haufen werfen, sind wir lieber bereit, Lügen zu glauben. Bevor wir die Schublade antasten, in die wir uns selbst gesteckt haben, korrigieren wir lieber die Attribute der anderen. Und da wir uns selbst unbedingt positiv und stimmig wahrnehmen möchten, ist es wahrscheinlich, dass es eher zu einer Abwertung der anderen Parteien kommt. Diesem Mechanismus können wir ein Schnippchen schlagen, indem wir ihn anerkennen und ihm bewusst entgegenwirken.

Wenn Schubladen ausarten
Identität ist komplex, hat aber einen trivialen Verwandten: das Wir-Gefühl, das uns an eine Gruppe bindet und gleichzeitig Abstand zu „den anderen“ schafft. Um ein Wir-Gefühl zu erzeugen, braucht es übrigens keine ethnische oder soziale Übereinstimmung. Es reicht, eine Uniform zu tragen. Oder nur die gleichen Hemden. Das gleiche Smartphone zu besitzen. Wenn wir nicht Acht geben, verlieben wir uns in dieses Wir-Gefühl so sehr, binden uns emotional so stark daran, dass wir es mit Identität verwechseln. Dies ist Voraussetzung für die Bereitschaft, nicht Zugehörige auszugrenzen und zu erniedrigen.
Für körperliche Gewalt oder sogar Mord ist noch ein weiterer Schritt vonnöten. Nachdem die eigene Identität mit der der Gruppe gleichgesetzt oder zumindest verknüpft wurde, sind wir unter bestimmten Umständen bereit, an ein Feindbild zu glauben und es zu entmenschlichen. Unter dieser Voraussetzung sind Völkermorde begangen und Sklaverei gerechtfertigt worden, alles mit der (emotional begründeten) Einstellung, dass jene, denen Gewalt angetan wird, minderwertig und untermenschlich seien.

Nun sind wir bei einem dunklen Kapitel angelangt, das an dieser Stelle nicht weiter vertieft wird, das aber die Wirkungskette aufzeigt, die unreflektierte Kategorisierungen im schlimmsten Fall nach sich ziehen können. Wir Menschen sind dazu veranlagt, in Schubladen zu denken. Es fußt auf unserem Bedürfnis der Zugehörigkeit und Bestätigung. Doch wenn wir nicht bereit sind, unser angeborenes Ego ohne Rettungsring über Bord zu werfen, wird es auch in Zukunft immer Kriege, Völkermorde und Sklaverei geben, denn Schubladendenken, so harmlos es anfangs ist, bildet den Nährboden für jedes Verbrechen.
Auch für sexuelle Diskriminierung.
Sag mir mit wem Du schläfst
…und ich sage Dir, wer Du sein willst.
Die Sexualität macht einen entscheidenden Teil unserer Selbstwahrnehmung aus. Sex ist nicht nur ein Grundbedürfnis. Es ist eine existenzielle Erfahrung, sich selbst, den Körper und die eigene Lust zu erleben, denn unabhängig von unseren Neigungen, dem Geschlecht oder der Anzahl an Sexualpartnern, sind wir dabei letztendlich immer auf uns allein gestellt. Wieso? Weil bewusster Sex im Kopf beginnt und auch dort seine Grenzen findet, in unserer eigenen, unablässig kreisenden, kommentierenden und produzieren Gedankenzentrale.
Das ist gut so, denn auf diese Weise können wir durch den Verstand die Auslebung unseres Triebes kontrollieren und moralische Vorstellungen einfließen lassen. Andererseits verleitet die verstandesmäßige Analyse der Sexualität uns, auch hier Schubladen zu erschaffen und uns selbst und andere fein säuberlich darin unterzubringen.
Homo, hetero, pan, bi, poly, asexuell?
Viele empfinden es als befreiend, sich einer Orientierung zuzuordnen, endlich ihre sexuelle Identität zu finden, endlich einen Begriff, eine Ahnung von Normalität zu haben, zu wissen, dass andere ihre Neigung teilen. Die Vorstellung, mit etwas so Sensiblem allein zu stehen, ängstigt uns, sodass wir mit einem Hechtsprung die vermeintliche Sicherheit der weit geöffneten Schublade suchen – mit all ihren Klischees und Vorurteilen. Wieder gehören wir einer Gruppe an, die sich durch eine Gemeinsamkeit definiert, wieder erfahren wir Ablehnung von anders Orientierten, wieder sind da Wir und die anderen. Wieder Abgrenzung, wieder eine erstarrte Identität, die keinen Raum für Entwicklung lässt. Sollte die sexuelle Präferenz sich einmal verändern, schlittern wir folgerichtig in die nächste Krise.
Ein Kreislauf, der niemandem guttut und den wir nur unterbrechen können, indem wir aufhören, einander in Schemata einzuordnen, die zu klein für uns sind. Denn ganz ehrlich, wen geht es wirklich etwas an, was wir in unseren Schlafzimmern – oder anderswo – treiben? Was sagt dieses Wort, das mit -sexuell endet, wirklich über uns aus? Sich mit einem Label zu bekleben, wirkt so, als wollten wir uns rechtfertigen für das, was wir sind. In einer Gesellschaft, in der Heterosexualität als normal weil häufig gilt, muss kein Hetero je darüber nachdenken, wie er sich outen soll. Dass so viel über “abweichende” Neigungen diskutiert wird, zeigt deutlich, wie schwer wir uns mit Gleichwertigkeit tun, die mit unserem Denken beginnt.

Mein Fazit
Auf die Frage, „was wir denn nun seien“, einfach mal mit „Mensch.“ antworten. Ein Mensch mit tausend Facetten, der jeder Schublade entwachsen ist. Ein Mensch, der das Recht auf ungehinderte Entfaltung in gegenseitigem Respekt nicht nur für sich selbst beansprucht, sondern auch jedem anderen Lebewesen gönnt. Der sich seiner Triebe ebenso bewusst ist, wie er seinen Verstand gebraucht. Ein Mensch, der vor sich selbst frei ist.
Dies ist der erste Artikel von Luisa. Was meinst Du dazu? Schreibe Deine Meinung als Kommentar und sei Teil der Community.
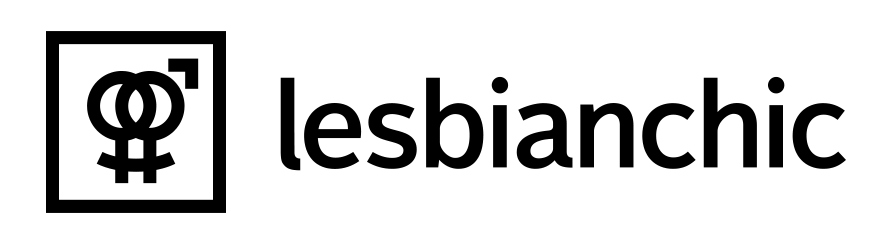




No Comment